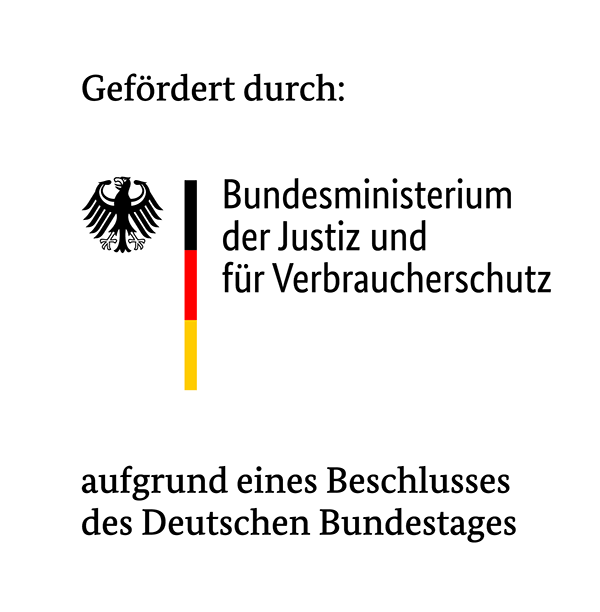Im vergangenen Jahr hat die EU-Kommission untersucht, wie wirksam europäische Gesetze Verbraucherinnen und Verbraucher in der digitalen Welt schützen. Ein zentrales Ergebnis: Nutzer sind nach wie vor problematischen Praktiken ausgesetzt – darunter auch den so genannten „Dark Patterns“. Doch was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff? Sind diese Methoden zulässig? Und welche Möglichkeiten haben Verbraucher, sich zu schützen?
Frau Halm, was sind Dark Patterns und wo begegnen sie uns?
Dark Patterns sind Designtricks auf Webseiten oder in Apps, die Nutzer gezielt zu Entscheidungen verleiten sollen, die für sie nachteilig sein können. Diese manipulativen Designs begegnen uns an vielen Stellen im Internet – etwa in Cookie-Bannern, bei Countdowns im Online-Shopping oder bei der erzwungenen Registrierung für einen neuen Account.
Wie funktionieren Dark Patterns?
Bei den Designs wird mit optischen, aber auch psychologischen Tricks gearbeitet. Die Informationen werden etwa nicht neutral dargestellt oder sind nur schwer auffindbar. Oft wird Druck aufgebaut, beispielsweise durch den Zwang zur Entscheidung, Irreführung oder künstliche Dringlichkeit. Ein typisches Beispiel ist der Countdown beim Online-Shopping. Mit Hilfe eines farblich hervorgehobenen und prominent platzieren Countdowns wird der Eindruck erweckt, dass ein Produkt nur für kurze Zeit verfügbar sei oder eine besonders große Nachfrage bestehe. Es wird suggeriert: Wenn du jetzt nicht zugreifst, ist es zu spät! Nicht immer entspricht diese Verknappung auch der Realität.
Warum setzen Unternehmen diese Gestaltungsmuster ein?
Der Einsatz von Dark Patterns dient in erster Linie wirtschaftlichen Interessen. Unternehmen wollen Nutzer zum Kauf verleiten, persönliche Daten abgreifen oder ihnen schlimmstenfalls ein Abonnement oder andere Verträge unterjubeln.
Sind Dark Patterns erlaubt?
Nicht alle manipulativen Designs sind verboten. Viele bewegen sich in einer rechtlichen Grauzone. Einige Gestaltungen sind jedoch klar untersagt. Der Digital Services Act, kurz DSA, etwa verbietet Plattformen, bestimmte Auswahlmöglichkeiten optisch stärker hervorzuheben, wenn der Nutzer eine Entscheidung treffen muss. Auch andere Regelungen greifen bereits, etwa die sogenannte Buttonlösung. Bei kostenpflichtigen Verträgen muss ein deutlich hervorgehobener Button auf die Zahlungspflicht hinweisen, um Abofallen zu verhindern.
Gibt es weiter Handlungsbedarf?
Ja, denn die Methoden entwickeln sich ständig weiter. Viele Regelungen greifen nur in Einzelfällen, etwa beim Onlinekauf. Die EU-Kommission sieht deswegen weiterhin Handlungsbedarf und prüft, wie Verbraucher künftig noch besser und grundsätzlicher vor Dark Patterns geschützt werden können.
Wie können sich Verbraucher selbst schützen?
Einen vollständigen Schutz gibt es kaum – Unternehmen setzen gezielt auf psychologische Tricks. Umso wichtiger ist es, wachsam zu bleiben. Wer sich bewusst macht, dass viele Online-Angebote manipulativ gestaltet sind, kann besser gegensteuern. Es hilft, kurz innezuhalten und Angebote und Anzeigen kritisch zu hinterfragen: Ist das Angebot wirklich so gut wie beworben? Muss ich tatsächlich sofort entscheiden? Brauche ich diesen Newsletter wirklich? Auch bei Cookies lohnt es sich, nicht automatisch aus Gewohnheit oder Bequemlichkeit zuzustimmen, sondern bewusst auszuwählen oder auch mal abzulehnen.